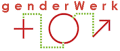Projektwoche RESPECT!
1. Motto
Das Motto der letztjährigen Projektwoche Toleranz (Znarelot) wurde dieses Jahr nicht wieder verwendet. Kritikabel am Toleranzbegriff ist das ihm innewohnende hierarchische Verhältnis: Toleranz muss nur der/dem gewährt werden, die/der keine Rechte hat. Werden nun Rechte von den Tolerierten eingefordert, kann es mit der Toleranz der Toleranten auch ganz schnell wieder vorbei sein. Die Unterscheidung in diejenigen, die zu tolerieren sind und die, die tolerieren und dazu auch von Geburt berechtigt sind, wird also verstärkt. Toleranz als Teil eines Machtgefälles ist nicht in der Lage, dieses in Frage zu stellen.
Für besser befunden wurde der Begriff Respekt. Respekt erkennt Subjekt-Subjekt-Beziehungen als solche an und geht von einer gleichberechtigten Beziehung verschiedener AkteurInnen aus. Dieses verbindende Element wiederum ist Voraussetzung für Veränderung.
2. Aufruf an die Jungs
(...) In Jungengruppen gilt es normalerweise, cool zu sein, über einen großen Schwanz und das letzte Sexabenteuer zu prahlen und seine Fachkenntnisse über das letzte Fußballspiel oder das neueste Automodell zum Besten zu geben. Das erzeugt bei vielen einen ungeheuren Druck: Kann ich das? Hab ich das? Bin ich cool? Grund für den Druck ist die fehlende Kultur, seine Schwächen, Sorgen oder Nöte zeigen zu können. Jungen lernen so etwas in aller Regel nicht. Auch nur allzu menschliche Bedürfnisse nach Nähe, Intimität, Vertrauen, Zuwendung, Bestätigung und Anerkennung haben in einer coolen Jungengruppe in aller Regel keinen Platz. So kann es zu der seltsamen Situation kommen, dass Jungen aufgrund des Coolness-Zwangs unter Umständen nirgendwo so einsam sind wie in der Gruppe. Zufrieden und glücklich macht das mit Sicherheit nicht...
So wird einerseits die Psyche zugrunde gerichtet, aber auch der (männliche) Körper. Als richtiger Junge ist mann nicht ein Körper, sondern mann hat einen. Typischer Jungensport ist Fußball, der nicht darauf ausgerichtet ist, seinen Körper bewusst wahrzunehmen und achtsam damit umzugehen. Im Fußball ist der Körper zuallererst dazu da, Leistung zu erbringen. Dies führt sehr oft zur Verletzung und massiven Schädigung des eigenen Körpers.
Uns geht es nicht darum, dass der Körper als Maschine gesehen wird, die etwas leisten muss. Der Körper hat nicht immer zu funktionieren; es geht uns nicht immer gut und wir sind nicht die starken Superhelden und das Leben als einsamer Cowboy macht auch nicht glücklich. Vielmehr geht es uns um Respect: sich selbst gegenüber, anderen Jungs gegenüber und gegenüber Mädchen und Frauen.
Hey Jungs! Lasst euch mal auf was ein, was jenseits von Kampf und Geprahle liegt. Auf zu neuen Ufern für Glück und Zufriedenheit! (...)
3. Körper
Warum sich mit dem Körper beschäftigen?
In der Dichotomie männlich-weiblich ist es schon unmännlich, die Wahrnehmung auf den eigenen Körper zu richten und zu versuchen, dessen Sprache zu verstehen. Der Körper ist für den Mann ein Instrument des Geistes, der weibliche Körper hingegen gilt als Körper par excellence. Der übliche Blick des Mannes auf seinen eigenen Körper ist von instrumenteller Art: er hat zu funktionieren. Ihm Aufmerksamkeit zu schenken und den Körper von seiner Geschichte erzählen zu lassen, sich Schwächen einzugestehen und die Verengungen und Ausschlüsse von Möglichkeiten verdeutlichen, die einem als Junge (bzw. Mädchen) verwehrt bleiben, kommt schon einer gewissen Subversion gleich.
Die Arbeit mit dem Körper ist in erster Linie eine Arbeit der Erfahrung. Sie hat daher häufig eine spielerische Form. Es kann sich dabei um Spiele des Anfassens, übungen des sich Spürens, Meditationen, Körperreisen, Vertrauensübungen, Massagen, Rollenspiele handeln, als eine Arbeit an der Vielfalt von Ausdrucksformen. Die Arbeit mit dem Körper kann auch verstanden werden als eine Arbeit am Blick auf den Körper. Zunächst stehen Wahrnehmung und Sensibilisierung für den (eigenen) Körper im Vordergrund. Es geht um Erfahrungen am und mit dem Körper, die seine Historizität oder die Bedingungen seiner Konstituierung selbst zum Inhalt haben. Ordnungsschemata, die sich an höher, weiter, schneller, besser orientieren und Erfahrungen in männlich-weiblich einordnen, werden verlassen bzw. irritiert.
An die Stelle der Suche nach versteinerten Identitäten, die immer schon geschlechtliche und sexuelle Verwerfungen [1] einschließen, tritt die Genealogie des Geschlechts und die Entwicklung von prozessualen Identitäten, die eine Gewordenheit und damit auch Wandelbarkeit vermitteln. So verstanden dient Körperarbeit dazu, den Körper zu einem Ort für eine Reihe sich kulturell erweiternder Möglichkeiten zu machen. [2]
Oberthema war für uns in dieser Woche der (männliche) Körper. Zusätzlich stand jeder Tag unter einem Sub-Thema was sowohl positiv für uns als Teamer als auch positiv für die Jungs war, da sie dadurch wussten, worum es grob gehen wird. Am Montag wurde in das Thema mein Körper eingestiegen, am Dienstag lag der Schwerpunkt auf Sport, am Mittwoch ging es um den GeschlechtsKörper, am Donnerstag um Sexualität und am Freitag war die Abschlusspräsentation zusammen mit der anderen Jungengruppen und den beiden Mädchengruppen.
Im Gegensatz zu den Teamern der anderen Jungengruppe ging es uns gerade nicht um eine Fixierung auf Mädchen/Frauen. Wir haben daher nicht wie es in der anderen Jungengruppe praktiziert wurde darüber geredet, wie ich ein Mädchen anmache (was in unseren Augen ohnehin unsinnig ist, da weder Mädchen/Frauen stereotyp sind noch alle Jungen heterosexuell leben). Vielmehr ging es uns statt dessen darum, Hilfestellungen dafür zu geben, eigene Gefühle wahrzunehmen, über sich reden zu lernen, Auseinandersetzungen mit dem eigenen Geschlecht anzustoßen. Daher haben wir, wie schon im letzten Jahr, beispielsweise die Form von Sexualität thematisiert, die vermutlich für die allermeisten Jungs (und Männer) die allerwichtigste und am häufigsten praktizierte ist: Selbstbefriedigung. Da wir diese Methode jedoch letztes Jahr in unserem Text ausführlich thematisiert haben, wollen wir im Folgenden auf andere Methoden eingehen und diskutieren, die wir in der Woche dieses Jahr angewendet haben.
Zuvor aber noch eine Anmerkung zur Methode: Wir arbeiten grundsätzlich prozess- und problemorientiert und nicht ergebnisorientiert. Dieses Vorgehen ist für die Jungenarbeit unserer Ansicht nach besonders wichtig, da es wenig glaubwürdig erscheint, ständig das (männlich-hegemoniale) höher-schneller-weiter zu problematisieren, selbst aber von der Arbeitsweise dem durchschnittlichen Schultakt und drill zu entsprechen, der eben leider nach wie vor aus dem Strukturquartett von Leistung, Hierarchie, Disziplin und Konkurrenz besteht.
4. Zweigeschlechtlichkeit, Homophobie & Heteronormativität
Am Mittwoch ging es thematisch schwerpunktmäßig um den Geschlechtskörper. Ziel unsererseits war es, einen Raum zur Reflexion einerseits zum Zusammenhang von Körper und Geschlecht, andererseits und das ist damit eng gekoppelt zum Zusammenhang von Männlichkeit und Heterosexualität zu schaffen. Zwei Methoden, um das zu erreichen, sollen im Folgenden vorgestellt werden.
- der Vorurteilswettbewerb
- das Zeigen des Films mein schwules Kaninchen
Da sich an beide Methoden längere Diskussionen knüpften was auch beabsichtigt war , werden wir versuchen, die genannten Methoden inhaltlich-theoretisch zu unterfüttern und arbeiten heraus, was genau mit den Methoden, zu denen die anschließenden Diskussionen elementar dazu gehören, erreicht werden sollte.
4.1 Der Vorurteilswettbewerb
Wir haben wie bei einer Quiz-Show im Fernsehen zwei Teams gebildet, die gegeneinander angetreten sind. Beide Teams bekamen Papier und Stifte und fünf Minuten Zeit, um aufzuschreiben, was einerseits Jungen/Männer nicht können bzw. nicht sind, andererseits Mädchen/Frauen nicht können bzw. nicht sind. Gewonnen hat in dieser ersten Runde das Team, welches die meisten Begriffe aufgeschrieben hat. In einer direkt darauf folgenden Runde hatte dann jedes Team im Wechsel Zeit, einen Begriff der anderen Gruppe wegzustreichen, wenn dies begründet werden konnte (z.B. Meine Schwester kann im Stehen pinkeln.
oder Ich zeige meine Gefühle.
). Gewonnen hatte in dieser zweiten Runde das Team, welches die meisten (nicht weggestrichenen) Begriffe übrig hatte (z.B. Jungen/Männer können nicht schwanger werden.
).
Im Anschluss haben wir Bezug nehmend auf den Vorurteilswettbewerb recht lange, intensiv und auch konfrontativ gemeinsam als Gruppe über Junge-/Mannsein, Geschlechtsidentität und Wahrnehmung gesprochen.
Exkurs zu Männlichkeiten
Männlichkeit bildet eine Position in einer symbolischen Geschlechterordnung, d. h. sie wird immer in Abgrenzung zu Weiblichkeit beschrieben (und zwar auf einer hierarchischen Achse, auf der sie überlegenheit, Autorität und die Norm markiert), ist demzufolge nicht statisch, sondern kulturellen und historischen Prozessen unterworfen. Auf der sozialen Ebene lässt sich Männlichkeit nur als eine Reihe von Prozessen und Praktiken fassen, die diese Position herstellen.
Innerhalb eines Machtgefüges werden Privilegien nach verschiedenen, aber miteinander Verbindungen eingehenden Kategorien verteilt. Die Kategorie gender ist in westlichen Gesellschaften, die ohne Umschweife als patriarchal bezeichnet werden können, wesentliches Verteilungskriterium. Dabei macht sich die Zuordnung innerhalb eines als zweigeschlechtlich behaupteten Systems an äußeren, nach Bio-logik wahrnehmbaren Geschlechtsmerkmalen Fortpflanzungsorganen fest. Wenn diese nicht der bipolaren Norm entsprechen, wird eben dran rumoperiert, bis eine Eindeutigkeit hergestellt ist (was insbesondere die Verstümmelung von Hermaphroditen meint). Die biolog(ist)ische Zuordnungseinheit männlich ist somit die erste Voraussetzung zur Erlangung gesellschaftlicher Dominanzpositionen und eröffnet ein Programm an Sozialisationsverfahren, das den Subjekten (Individuen) einerseits bestimmte Rollenerwartungen nahelegt, sie gleichzeitig aber auch zu aktiven Mitgestaltern ihrer Identitätsrepräsentationen macht. Dies muss als ein Projekt betrachtet werden muss, welches nie abgeschlossen ist.
Hier wird auch bedeutend, in welchen anderen Zuschreibungsachsen (Verhältnissen) sich das Subjekt noch befindet: Hautfarbe, Klassenzugehörigkeit, sexuelle Orientierung, Ethnizität, Körperbau, die Position in der Weltordnung, etc. Die sozialen Männlichkeiten bilden sich in Abhängigkeit zu diesen Kategorien aus; dabei können individuelle Sozialisationserfahrungen höchst unterschiedlich sein, sind aber nie unabhängig von diesen Faktoren sein. Die Männlichkeitskonzeptionen stehen in einem dynamischen Verhältnis zueinander. Abgesehen von der Abgrenzung von den jeweiligen gesellschaftlich existenten Weiblichkeitskonzeptionen produzieren sie sich auch durch Abgrenzung untereinander. Hierbei gibt es hegemoniale, komplizenhafte, marginalisierte und untergeordnete Männlichkeiten. [3]
Eben gerade weil Männlichkeit als Praxis prozesshaft ist, ging es uns einerseits darum, genau das ins Bewusstsein zu rufen, andererseits aber auch Bildstörungen zu produzieren. Da in unserem kulturellen Kontext "Geschlecht" und "Körper" eine regelrecht symbiotische Beziehung miteinander führen, soll dem sozialen Umfeld über Gestik, Bewegung, Kleidung, Sprache, Körperformen, usw. das eigene Geschlecht glaubwürdig dargestellt, quasi versichert werden. [4]
Wir haben dann einem Jungen (der in der Gruppe eine hegemoniale Stellung hatte und sich daher gut verteidigen konnte) in der Auseinandersetzung über Männlichkeitsvorstellungen nach der Quiz-Show vorgeworfen, uns zu verheimlichen, dass er eine Scheide habe und daher ständig nur so tue, als sei er ein Junge. Die Empörung war wie zu erwarten bei allen groß und eine heftige und kontroverse Diskussion entstand. Ziel unsererseits war die Vermittlung der simplen Tatsache, dass jede Geschlechtsidentität als sich permanent wiederholende Konstituierung begriffen werden muss gewissermaßen als eine Imitation, zu der es kein Original gibt. Kritisiert werden sollte ein Denken, welches von äußerlichkeiten und Verhalten auf biologische Tatsachen schließt, diese aber als ursächlichen Grund für eben diese äußerlichkeiten und ein bestimmtes Verhalten annimmt (sieht aus wie ein Junge, hat also einen Penis, verhält sich also wie ein Junge). Diese (irrationale) gedankliche Konstruktion wurde in der Diskussion aufgegriffen und kritisiert. Mit Erfolg wie wir sagen würden, da von einem der Jungen irgendwann der Satz fiel, dass wir somit eigentlich alle ständig Schauspieler seien. Und ständig zu schauspielern und sich nicht so geben zu können, wie man(n) gerade gerne möchte, ist ohne Zweifel anstrengend.
Wir hatten noch ein Buch über (bewusst lebende) Transgender mit, wo Anfangs immer wieder von den Jungen stereotyp gefragt wurde, ob das jetzt ein Mann oder eine Frau sei. Irgendwann merkten sie, dass diese Frage einfach nicht in der Lage ist, die Menschen, die sie sahen, zu beschreiben. Es kam zu einer Irritation des für sie gewohnten geschlechtsdualistischen Blicks.
Schwierig war hierbei, dass die bewusst als Transgender lebenden Menschen so teilweise als "Freaks", die von einem selbst ganz weit entfernt sind, rüberkamen. Dies wurde zusätzlich dadurch verstärkt, dass in dem Buch überwiegend Frau-zu-Mann-Transgender abgebildet waren, diese für die Jungs noch weiter weg waren und sie sich so ihrer eigenen Männlichkeit versichern konnten. Andererseits diente es uns als Aufhänger für oben beschriebene Diskussion und für eine Ausweitung auf jeden Geschlechtshabitus [5], der immer Travestie ist und ein Geschlecht darstellt. Angegriffen wurde so der bipolare männlich-weiblich-Blick, nach dem alles sortiert, kategorisiert und bewertet wird.
Und von diesem Punkt aus sind wir dann auf den Vorurteilswettbewerb zurückgekommen, der aufzeigte, welche (unnötige) Bedeutung den verschiedentlich übrigbleibenden Unterschieden bleibt. Da nur biologische Unterschiede übrig blieben und das waren mit der Anzahl der ursprünglich aufgeschriebenen Begriffe vergleichsweise wenige , stellt dies einen Bedeutungsverlust der klassischen Symbole zweigeschlechtlicher Ordnungen und das meint soziale Ordnungen dar. Der Vorurteilswettbewerb eignet sich hierfür besonders gut, da die Jungs regelrecht darum konkurrieren, dem anderen Team aufzuzeigen, dass Jungen/Männer bzw. Frauen/Mädchen alles können/sind und die Vorannahmen, Klischees, Bilder und Stereotypen von sich aus widerlegen - was im übrigen sehr nett zum Zusehen und Zuhören ist.
4.2 Mein schwules Kaninchen
Der Kurzfilm (17 Min.) Mein schwules Kaninchen handelt von Caroline, ein Mädchen, dessen Kaninchen sich nach einer Operation für das eigene Geschlecht interessiert. Die Eltern sind sauer auf Caroline, machen ihr verschiedenartige Vorwürfe (z.B. es ist schwul, weil dein Zimmer zu dreckig ist
) und es kommt zu einem großen Familienkrach. Die Eltern töten das Kaninchen letztendlich. Caroline wird depressiv, bis sie von ihren Eltern zu einer Psychologin geschickt wird, die ihr hilft. Der Film endet damit, dass es Caroline besser geht, die Psychologin aber gerne mit den Eltern sprechen möchte.
Exkurs zu Sexualitäten & Männlichkeiten
Sexualität wird hier nicht als sexuelle Handlung in Form von Sex gedacht, sondern als gesamtgesellschaftlicher Vorgang der Vergeschlechtlichung von Personen: durch eine sexualisierende Praxis [6] werden vergeschlechtliche Personen hergestellt (was im übrigen einer der Gründe ist, warum die Auseinandersetzung mit Sexualität so wichtig in der Jungenarbeit ist). Die Kopplung von sex und gender lässt anatomisches Geschlecht, Geschlechtsidentität, Begehren und entsprechende Praktiken in eins fallen. [7]
Mann sein heißt also unter gegenwärtigen Bedingungen immer auch ganz elementar, heterosexuell aktiv zu sein. Ein fehlendes Bekenntnis zur Heterosexualität wirkt als Rausschmiss aus der Männlichkeit sie wird aberkannt, weil sie sich nicht an die elementare Regel, ein weibliches Objekt zu begehren, hält. Man könnte meinen, in der symbolischen Ordnung müssten Schwule eigentlich bei "Weiblichkeit" landen, aber auch wenn dieses das Lieblingsressentiment der heterosexistischen Zwangsgemeinschaft ist, tun sie das nicht, genauso wenig, wie Lesben erfolgreich Männlichkeit erwerben würden; wer sich nicht an die "natürliche" Ordnung hält, fliegt auch aus der symbolischen. Interessant ist auch der Umgang mit Bisexualität, sie existiert in der gesellschaftlichen Wahrnehmung fast überhaupt nicht. Nichtsdestotrotz existieren Schwule natürlich als Männer mit allen möglichen überzeugenden Inszenierungen - bis auf die der Heterosexualität, was für das soziale (heteronormative) Gefüge eine permanente Irritation bedeutet. [8]
Geschlecht kann demzufolge als komplexer gesellschaftlicher Prozess verstanden werden, dem als regulierendes Prinzip eine heterosexualisierende Matrix [9] zugrunde liegt. Deren Effekte sind Normen von Zweigeschlechtlichkeit und Heterosexualität. Das heißt u.a., dass es Schwule (Lesben) genau so wenig wie Heterosexuelle oder auch Bisexuelle gibt; beide werden gesellschaftlich erzeugt und sind deswegen "da". [10]
Gesa Lindemann zufolge richtet sich Begehren danach, ob das Gegenüber gleich- oder verschiedengeschlechtlich ist. Gleichzeitig stabilisiert sich durch die Wahrnehmung des Gegenüber so die Vorstellung davon, welches Geschlecht das begehrende Subjekt besitzt. Sexuelles Begehren, Evidenz des eigenen Geschlechts und die Wahrnehmung des Geschlechts anderer bedingen also einander wechselseitig. [11]
Was heißt das für die Sozialisation von Jungen und für eine emanzipatorische Jungenarbeit?
In der Jungensozialisation gilt hegemoniale Männlichkeit (männliches Ideal) als wesentliche Richtschnur - jedoch: sie sind ein unerreichbarer Standard. Jungen sind ständig bedroht von potentiellem Versagen. Sie müssen ständig befürchten, von der Normalität ausgeschlossen zu werden. Weil es mit einem brüchigen Selbst kaum stabil gelingt, Individuum zu werden, ist normal zu sein für viele Jungen und Männer sehr wichtig; sie stehen oft unter einem hohen Normalitätsdruck. Viele Jungen wollen und müssen deshalb klar unterscheiden, was männlich ist und was nicht. In Bezug auf sexuelle Orientierungen ist dies die aktive Heterosexualität.
Sich gegenseitig als schwul zu bezichtigen und zu betonen, dass man selbst nicht schwul sei, gehört zu den ritualisierten Umgangsformen vieler Jungencliquen. Bei Jungencliquen kommt es zu einem Paradox: sie dient einerseits als emotionaler Fluchtpunkt aus der Familie heraus, ist aber aufgrund der Nähe unter Jungen potentiell bedrohlich und gleichzeitig homoerotisch aufgeladen. Notwendig für die Selbstvergewisserung als Mann was, wie oben näher erläutert, immer heterosexuell aktiver Mann meint ist von daher in einer Jungen-/Männerclique die ständige Betonung (Reinhard Winter spricht treffend von einem Betonungssyndrom) der eigenen Heterosexualität (male bonding among heterosexuals). Die Abwertung von Homosexualität schützt zum einen vor dem Homosexualitätsverdacht, zum anderen wird die eigene Männlichkeit aufgewertet und stabilisiert.
Die Abwertung des Nicht-Männlichen bündelt sich in Projektionen auf Homosexualität. Homosexuelle und ein regelrecht mythisch aufgeladener Begriff von Homosexualität dienen vielen Jungen als Projektionsfläche für eigene unerledigte Fragen oder abgespaltene Anteile. Wenn Jungen sich abwertend über Homosexualität äußern, teilen sie etwas über sich selbst, über eigene Defizite mit.
Nicht zufällig sind es vor allem Körperbilder, die Jugendliche produzieren, wenn sie Homosexualität darzustellen versuchen: Bilder dessen, was bei den Jungen selbst nicht sein darf. Körperhaltungen, Gestik und typische Posen werden von Jugendlichen als erkennbare Körperrepräsentanten für Homosexualität herangezogen und über die "spielerische" Darstellung abgewertet. Besonders die Körperprojektionen können Aufschluss darüber geben, was den Jungen und Männern fehlt und die Perspektive dafür öffnen, welche körperlichen Anteile zu integrieren sind. [12]
In dem Film mein schwules Kaninchen steht das Kaninchen als Symbol für nicht-normierte, d.h. nicht-heterosexuelle, Sexualität und die Eltern stehen stellvertretend für eine heterosexistische Gesellschaft bzw. für hetoronormative Werte. Caroline kennt diese soziale Ordnung (noch) nicht sie wird ihr von den Eltern mit aller Brutalität beigebracht. Mit dem Film lassen sich eine Reihe von Fragen zu Homo- und damit eben auch zu Heterosexualität aufwerfen. Mit der Frage, ob es ein schwules Kaninchen überhaupt geben kann, kann Homosexualität als soziale Konstruktion und dennoch wirkmächtige Vorstellung thematisiert werden. Und die Frage, warum die Psychologin die Eltern sprechen möchte, leitet über zu einer Diskussion über Heteronormativität und Heterosexismus getreu dem Rosa von Praunheimschen Filmtitel: Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er sich befindet. Von hier aus kamen wir schnell zu anderen Themen.
Die Diskussion war, wie die oben bereits geschilderte, recht konfrontativ. Nach einer gewissen Zeit haben wir der Reihe nach jedem Jungen die Frage gestellt, ob er einem schwulen Mitschüler helfen würde, wenn dieser aufgrund seines Schwulseins diskriminiert würde. An die Antworten knüpften sich weitere Fragen, so dass wir teilweise einzelne Jungs mit 6, 7 Fragen hintereinander regelrecht bombardierten. Würdest du helfen?, Warum nicht?!, Du hast doch vorhin gesagt, alle sollen frei ihre Sexualität leben können. Wenn jemand deswegen bedroht wird, kann er das nicht. Warum sagst du jetzt, es interessiert dich nicht?, ... Unterm Strich haben einige gesagt, dass sie einem schwulen Mitschüler helfen würden, wenn dieser aufgrund seines Schwulseins bedroht würde. Verglichen mit den Statements, die zu Anfang der Diskussion kamen und auch der Tatsache Rechnung getragen, dass diese äußerungen eher von Jungen kamen, die in der Gruppe keinen einfachen Stand haben, mag das zwar wenig erscheinen, ist aber doch ein überaus mutiger Akt. Des weiteren muss auch immer gesehen werden, dass die langfristigen Wirkungen einer solchen Diskussion häufig noch mal mehr ändern als in der unmittelbaren Diskussionssituation.
Es war dennoch auch ernüchternd. Nach über einer halben Stunde intensiver Diskussion haben wir die Jungen abschließend gefragt, ob sie mit einem guten Freund kuscheln würden. Ohne auch nur eine Zehntelsekunde zu zögern kam das "Nein" sofort. Die Bedrohung, die von männlicher emotionaler und/oder körperlicher Nähe ausgeht, schafft einen distanziert-geregelten Umgang unter Männern. Dies wiederum ist ein spannender und auch trauriger Punkt in der Sozialisation von zumindest sehr vielen Jungen. Nur wenige Jahre jüngere Jungs [13] fassen sich selbst oder auch ältere Männer viel eher an; die Vorstellung, eventuell schwul zu sein, existiert schlichtweg noch nicht. Nähe unter Männern ist aber auch klassen- und race-abhängig. So ist die gelebte Nähe unter beispielsweise männlichen Jugendlichen (für erwachsene Männer gilt das gleiche) mit arabischem Background häufig viel intensiver als unter deutschen Jugendlichen.
4.3
Jungenarbeit möchte allzuhäufig nur ein gerechteres, gleichberechtigteres, erfüllteres, etc. Verhältnis zwischen Frauen und Männern schaffen was selbstverständlich zunächst in jeder Hinsicht zu unterstützten ist. Problematisch daran ist jedoch, dass das Verhältnis zwischen Homo- und Heterosexualität häufig nur als Nebeneffekt unter Vervielfältigung der männlichen Lebensweisen subsumiert und nicht zum Schwerpunkt erhoben wird. Bis hierhin sollte klar geworden sein, dass auf der Ebene der Vorstellungen von Männlichkeit, also auf der symbolischen Ebene der Geschlechterordnung, Männlichkeit immer an aktives heterosexuelles Verhalten geknüpft ist was nichts daran ändert, dass die real gelebten männlichen Existenzweisen häufig alles andere als durchweg heterosexuell, sondern de facto häufig homoerotisch aufgeladen sind.
Zur Herstellung und Stabilisierung von männlicher Identität gehört die Abgrenzung vom Weiblichen und die ständige Bestätigung sich selbst und anderen gegenüber, dass mann eben nicht Frau ist. Diese Bestätigung geschieht durch einen sich ständig wiederholenden Prozess der Selbstinszenierung von Männlichkeit. Die selbstgemachten Ausschlüsse stellen eine immer wiederkehrende Gefährdung der Identität dar, die durch eine immer stärkere Selbststilisierung gegenüber dem Anderen abgewehrt werden muss.
Anstatt dem Weg der Identitätsstabilisierung zu folgen, geht es einer identitätskritischen Perspektive umgekehrt darum, die Brüchigkeit und Wandelbarkeit als Eigenschaft von Identitäten zu begreifen. Und zwar als positives Kriterium, nicht als Bedrohung. Daran knüpft sich die Frage, wie die Restabilisierung von geschlechtlichen und sexuellen Identitäten zugunsten von prozessualen Identitäten verschoben werden kann. Das Ziel einer nicht-identitären Jungenarbeit wäre somit nicht der "andere Junge", sondern gar kein Junge [14]. Das gilt auch für Sexualitäten: Der Nicht-Junge wäre weder hetero-, noch homo- oder bisexuell. [15]
5. die Abschlusspräsentation
Das Ziel der Zerstörung von Identitäten ernst genommen, sind ganz besonders die Momente spannend, wo gesellschaftlich gewaltsam hergestellte Gruppen (wie es Jungen und Mädchen eben sind) nach einer solchen Woche am Ende (Freitag) aufeinandertreffen. Schließlich ist weder die Jungen- noch die Mädchenarbeit Selbstzweck; sie trägt lediglich einer heterosexistischen zweigeschlechtlich-hierarchischen Ordnung Rechnung. Da es ja aber gerade darum geht, diese in Frage zu stellen, erübrigen sich perspektivisch auch reine Jungen- und Mädchengruppen.
Die Abschlusspräsentation hätte also dazu dienen können, die anderen Gruppen und damit sind sowohl die andere Jungengruppe wie auch die beiden Mädchengruppen gemeint mit dem in der Woche Erarbeiteten zu überraschen, zu irritieren und ganz konkret aus dem gewohnt-bekanntem Habitus als Junge zumindest ein Stück weit herauszugehen. Der konkrete Ablauf unsere Jungs haben jeden Tag einzeln vorgestellt war in unseren Augen jedoch ein regelrechtes Desaster. Nicht, weil unsere Jungs nicht mitgemacht hätten, sondern weil von den Mädchen aus ihrer Klasse und den Jungen und Mädchen aus der anderen Klasse gelacht wurde. Das Gefühl des Ausgelacht-werdens hat die Jungen regelrecht in ihre alten Muster reingedrängt und alles, was nicht zu ihrer für alle sichtbaren und bekannten Coolness gehörte, hatte keinen Platz mehr. Das ist gerade deswegen so dramatisch, weil keine Veränderung ohne Bestätigung abläuft. Und da sich einerseits Jungen (für Männer gilt das gleiche) in aller Regel untereinander keine Anerkennung geben, ganz besonders aber nicht für jungenuntypisches Verhalten und andererseits im Rahmen einer heterosexuellen Matrix die Bestätigung als Junge (Mann) gerade von Mädchen (Frauen) erwartet und geholt wird, war das (Aus)Lachen gegenüber den Jungen und zwar von der anderen Jungengruppe wie auch von den Mädchen in unseren Augen ein herber Rückschlag.
6. Ausblick
Spätestens bis hierhin dürfte deutlich geworden sein, dass Jungenarbeit immer auch eine intensive Auseinandersetzung mit sich selbst erfordert der eigenen Männlichkeit, eigenen homophoben Anteilen, Konfliktverhalten, Begehrensstrukturen und vielem mehr.
Kritisch sei zum Abschluss noch angemerkt, dass wir uns eine Woche mit dem Körper beschäftigt haben und dabei ein elementares Kriterium unterschlagen haben: das der Hautfarbe. Alle teilnehmenden Jungen als auch wir sind weiß. Obwohl die Hautfarbe als sofort sichtbarer Teil des Körpers als absolut zentral für die eigene Identitätsbildung angesehen werden muss, war sie bei uns kein Thema. Diese letzten Zeilen sind also als Selbstkritik zu verstehen. Wenn es um Rassismus [16] geht, wird dieser in aller Regel auf eine interaktionistische Situation zwischen zwei Menschen oder zwei Gruppen reduziert.
Wir möchten dagegen zunächst für ein Verständnis von Rassismus plädieren, bei dem es weniger um benannte interaktionistische Begegnung geht, sondern selbigen als ein Herrschaftsverhältnis benennen, welches Menschen an einen ganz bestimmten Platz in dieser Gesellschaft setzt. Diese Positionierung hat zur Folge, dass es ein fein abgestuftes System von Ein- und Ausschlüssen gibt, das Menschen unterschiedliche Räume und Zugänge zu Ressourcen öffnet und eine tatsächliche Begegnung oftmals gar nicht stattfindet. Wenn sich also beispielsweise in einer Jugendeinrichtung in Marzahn-Hellersdorf nur weiße Deutsche aufhalten, dann liegt das mitnichten daran, dass es in Marzahn-Hellersdorf keine Menschen gibt, die von Rassismus betroffen sind (Nicht-Weiße, nicht-"deutsch"-Aussehende, Menschen ohne deutsche StaatsbürgerInnenschaft, ...) - diese gibt es sehr wohl -, und es liegt auch nicht daran, dass diese keinen Bedarf an einer solchen Einrichtung hätten. Nein, vielmehr handelt es sich hier um eine rassistische Struktur, an der eben alle ein Teil sind.
Diese überlegung soll die Notwendigkeit verdeutlichen, sich mit seiner eigenen Positionierung und somit eben auch (!) mit der anderer zu beschäftigen. Hierbei geht es eben nicht um ein fremd-machen (othering) von Anderen, sondern darum, bei sich zu bleiben und das eigene Weiß- (und Deutsch-)Sein kritisch zu thematisieren. Ziel dieses Unterfangens ist es, Brüche, Widersprüche und Risse im herrschenden rassistischen Gefüge aufzuspüren und zu verstärken genau so, wie es eine emanzipatorische Jungenarbeit mit Männlichkeit und Heterosexualität ohnehin schon versucht.
Da emanzipatorische Jungen- und Mädchenarbeit ihre weißen Flecken verstärkt thematisieren muss, sollen als Allerletztes noch drei Thesen aufgestellt und damit ein Anstoß zum Weiterdenken gegeben werden. In Anlehnung an Ruth Frankenberg ist Weiß-Sein:
- ein Ort, ein Standpunkt, von dem aus Weiße Leute sich selbst, andere und die Gesellschaft betrachten und bestimmen.
- ein Ort, der selbst unsichtbar, unbenannt, unmarkiert ist, und dennoch Normen setzt.
- ein Ort struktureller Vorteile und Privilegien. [17]
Vielleicht gelingt es ja, Rassismus verstärkt als Thema in die Jungen- und Mädchenarbeit einzubringen wünschenswert wäre es. Für Glück und Zufriedenheit (wofür wir weder Männlichkeit noch Heterosexualität noch Weiß- oder Deutschsein benötigen)!
Fußnoten und Referenzen
[1] Verwerfung meint hier den Ausschluss all dessen, was weiblich oder homosexuell konnotiert ist.
[2] Größtenteils wortwörtlich übernommen aus: Stuve, Olaf: "Queer Theory" und Jungenarbeit. Versuch einer paradoxen Verbindung. In: Fritzsche, Bettina / Hartmann, Jutta / Schmidt, Andrea / Tervooren, Anja (Hrsg.): Dekonstruktive Pädagogik. Erziehungswissenschaftliche Debatten unter poststrukturalistischen Perspektiven. Leske + Budrich, Opladen, 2001, S. 290ff.
[3] Größtenteils wortwörtlich übernommen aus: Differenzen in Sexualitäten und Männlichkeiten. In: Reader zur crossover conference, Bremen, 17.-20.1.02, S. 24.
[4] Rüter, Christian: Der konstruierte Leib und die Leibhaftigkeit der Körper. Die Relevanz des Körpers für eine Männer-Erforschung. In: BauSteineMänner (Hg.): Kritische Männerforschung. Neue Ansätze in der Geschlechtertheorie. Argument Verlag, Hamburg 2001, 3. Auflage (1. Auflage 1996), S. 96.
[5] Der Geschlechtshabitus ist einverleibte, zur Natur gewordene und damit als solche vergessene Geschichte: Geschlecht ist in den Körper eingeschrieben, der Körper weiß, wie er sich verhalten muss, um als Mann bzw. Frau (an)erkannt zu werden. Ausgebildet wird der Habitus korrespondierend zur jeweiligen Soziallage und wirkt als Handlungs-, Wahrnehmungs- und Denkmatrix. Ein Geschlecht existiert nur dadurch, dass die Angehörigen einer Geschlechtskategorie gemäß einem Prinzip handeln, das für diese, nicht aber für die andere Geschlechtskategorie Gültigkeit hat. Mit dem Konzept des Geschlechtshabitus wird nicht in Frage gestellt, dass Geschlecht sozial konstruiert ist; gleichzeitig ermöglicht diese Perspektive aber auch zu gucken, wie Mann-/Frausein sich in einer unterschiedlichen sozialen Praxis reproduziert, wie Männer und Frauen tatsächlich existieren.
[6] Mit sexualisierender Praxis ist die Wahrnehmung von Menschen als Männer und Frauen gemeint und ein ihnen gegenüber unterschiedliches Verhalten.
[7] Kalender, Ute: Jenseits der Feuerwehr. In: Phase 2, Nr. 9, September 2003, S. 57f.
[8] "Differenzen in Sexualitäten und Männlichkeiten", S. 25.
[9] Gesellschaftliche Ordnung, die permanent Heterosexualität herstellt.
[10] Das eben Ausgeführte ist nicht als Kritik an schwulLesBischen Emanzipationsbestrebungen zu lesen, sondern vielmehr als Angriff auf heterosexuelle Selbstentwürfe und ein Verständnis von Sexualität, das wesentlich mehr meint als nur die sexuellen Vorlieben. So ist ein "Schwuler" einem solchen Verständnis nach eben nicht einfach nur ein Mann, dem Sexualität mit anderen Männern Lust bereitet, sondern er ist in allem, was er macht, "schwul": beim Essen, schlafen, ins Kino gehen oder auf der Arbeit.
[11] Rüter, Christian: Der konstruierte Leib und die Leibhaftigkeit der Körper. Die Relevanz des Körpers für eine Männer-Erforschung, S. 99.
[12] Winter, Reinhard: Jungensozialisation: Gewalt gegen Schwule als Problemlösung? In: Senatsverwaltung für Schule, Jugend und Sport (Hg.): Opfer - Täter - Angebote. Gewalt gegen Schwule und Lesben. Dokumente lesbisch-schwuler Emanzipation des Fachbereichs für gleichgeschlechtliche Lebensweisen, Nr. 15. Berlin, 1996 (1. Auflage), S. 57-61.
[13] "unsere" waren 15-16 Jahre alt.
[14] Vergleiche hierzu ausführlicher: Krabel, Jens / Schädler, Sebastian: Dekonstruktivistische Theorie und ihre Folgerungen für die Jungenarbeit. In: Heinrich-Böll-Stiftung (Hg.): Alles Gender? Oder was? Dokumentation einer Fachtagung, Nr. 18, 1. Auflage, Oktober 2001.
[15] Im Gegensatz zu einer breiter diskutierten Vision, wie eine Gesellschaft aussehen könnte, die nicht mehr zweigeschlechtlich organisiert ist, wird dies unserer Ansicht nach zumindest in Ansätzen auf dem Feld der Sexualität getan: Kampfbegriff und ein Stück weit auch Utopie ist Queerness bzw. queeres Begehren.
[16] Begrifflichkeiten wie "Fremden-" oder "Ausländerfeindlichkeit" verwenden wir bewusst nicht, da diese nicht in der Lage sind, das Problem zu erfassen. "Fremdenfeindlichkeit" muss kritisiert werden, da sich Rassismus gegen bestimmte Menschen(gruppen) richtet, die erst in einem Prozess zu Fremden gemacht werden und genau das das Problem darstellt - nicht, wie es der Begriff nahe legt, die Feindlichkeit zwischen scheinbar schon immer existierenden Gruppen. "Ausländerfeindlichkeit" erkennt nicht nur Nationalstaaten an (wo es "Ausländer" gibt, gibt es auch "Inländer"), wobei diese jedoch zentral an der Herausbildung von nationalen und 'rassifizierten' Kollektiven beteiligt sind, sondern wird darüber hinaus als Begrifflichkeit der Lage von beispielsweise Deutschen mit migrantischem Hintergrund nicht gerecht. Diese sind nämlich sehr wohl von Rassismus betroffen, sind aber keine "Ausländer".
[17] Nach: Wachendorfer, Ursula: Weiß-Sein in Deutschland - Zur Unsichtbarkeit einer herrschenden Normalität. In: Arndt, Susan (Hg.): AfrikaBilder - Studien zu Rassismus in Deutschland. Unrast-Verlag, Münster, 1. Auflage, Oktober 2001, S. 87-101.